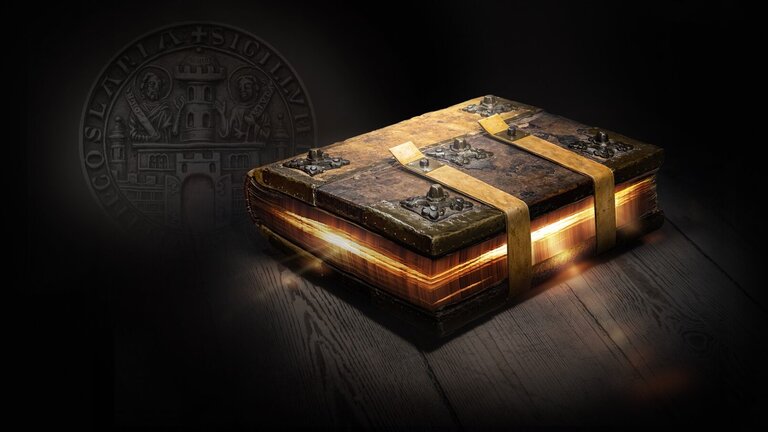
Die historische Stadtbefestigung und imposante Bauten wie die Kaiserpfalz, das historische Rathaus, das St. Annenhaus oder das Große Heilige Kreuz lassen Geschichte lebendig werden.
Obwohl zwei verheerende Brände, 1728 und 1780, mehr als 200 Gebäude zerstört haben.
Zum 1. Januar 2014 wurden Goslar und die bis dahin selbstständige Stadt Vienenburg fusioniert. Seitdem gehören auch die Stadtteile Immenrode, Lengde, Lochtum, Vienenburg, Weddingen und Wiedelah mit ihren rund 10.000 Einwohnern zu Goslar.
Chronologie
Im Zusammenhang mit der Intensivierung des Bergbaus im Oberharz (Silber) und am Rammelsberg (Kupfer) wächst eine Siedlung im Tal an der Gose langsam zur Stadt Goslar heran.
Erste Erwähnungen einer Pfalz in Goslar (vermutlich ein Vorgängerbau an Stelle der heutigen Kaiserpfalz).
Mit der Stiftskirche St. Simon und Judas ("Goslarer Dom") und dem heute noch existierenden Saalbau der Kaiserpfalz entstehen unter Kaiser Heinrich III. zwei der großartigsten Bauten der Salierzeit. Die Goslarer Pfalz wird zu einem der wichtigsten Herrschaftsorte des Reiches.
Der Sohn Heinrichs III., sein späterer Nachfolger Heinrich IV., wird in Goslarer geboren.
Heinrich der III. stirbt auf einem Jagdausflug in Bodfeld. Sein Leichnam wird nach Speyer überführt, sein Herz dagegen bleibt in Goslar. Es ist heute in der zur Pfalz gehörigen St. Ulrichskapelle beigesetzt.
Goslar wächst zu einer mittelalterlichen Großstadt mit annähernd 5000 Einwohnern, einer Stadtbefestigung, fünf Pfarrkirchen und vier Stiftskirchen heran. Die Wirtschaft basiert auf Bergbau und Hüttenwesen, der Zentrumsfunktion für die Bergbauregion Harz, Metallhandel und einer Münzprägestätte.
Letzter Reichstag unter Kaiser Friedrich II., der Goslar ein Stadtrechtsprivileg erteilt. Dieses wird zur Grundlage des 1330 kodifizierten Stadtrechts.
Mit Wilhelm von Holland besucht zum letzten Mal ein Herrscher die Kaiserpfalz.
Der Hildesheimer Bischof Johann I von Brakel sichert in einer Urkunde der Sankt Johannis Bruderschaft am Rammelsberg, die zur Unterstützung armer und schwacher Bergleute und deren Hinterbliebenen gegründet worden war, seinen Schutz zu. Diese Urkunde beinhaltet erstmals einen Hinweis auf eine organisierte Sozialfürsorge und bildet den Ursprung der Knappschaft und der deutschen und europäischen Sozialversicherung.
Neuere Ausgrabungen belegen ein erstes Hospital für erkrankte oder verletzte Bergleute an der St. Johanniskirche am Rammelsberg. Es ist eines der ersten Hospitäler in der gesamten Region.
Durch Erwerb der Reichsvogtei und Verleihung des Heerschildrechts wird Goslar Freie Reichsstadt. Schon 20 Jahre zuvor ist Goslar Mitglied in einem regionalen Städtebund, der später in der Hanse aufgeht.
Erwirbt Goslar Gericht und Zehnten am Rammelsberg pfandweise vom Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel, das sich aber das Rückkaufsrecht vorbehält.
Nach annähernd 100 Jahren geringer Produktivität und zeitweiligem Erliegen des Bergbaus am Rammelsberg beginnt eine Phase großer Erträge, die für Goslar eine wirtschaftliche Blütezeit bedeutet. In dieser Zeit entsteht das noch in großen Teilen erhaltene spätmittelalterliche Stadtbild mit Bauwerken wie dem Rathaus, Gildehäusern, der letzten Ausbaustufe der Stadtbefestigung und gotischen Um- und Ausbauten an den Kirchen.
Durch Rückzahlung der Pfandgelder fordert das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel seine Rechte an Rammelsberg und Forsten zurück. Jahrzehntelange Auseinandersetzungen folgen, die sich dadurch noch verschärfen, dass die Stadt die kirchlichen Gebäude jenseits der Stadtmauern zerstört und in Goslar 1528 die Reformation eingeführt wird, während das Herzogtum katholisch bleibt.
Goslar sieht sich gezwungen, im Riechenberger Vertrag alle Rechte am Rammelsberg und den Forsten an das Herzogtum Braunschweig-Wolfenbüttel abzutreten. Im Zeitalter des sich intensivierenden Fürstenabsolutismus und des beginnenden Überseehandels wird aus der freien Reichs- und Hansestadt Goslar nach und nach eine bedeutungslose Landstadt.
Im 30jährigen Krieg besetzen schwedische Truppen die Stadt. Hohe Tributforderungen und Plünderungen beschleunigen den wirtschaftlichen Niedergang.
Zwei verheerende Stadtbrände treffen die Stadt und vernichten jeweils mehr als 200 Gebäude.
Mit der Inbesitznahme der Stadt durch Preußen endet die 512 Jahre dauernde Epoche als Freie Reichsstadt. Mit der Eingliederung in einen Staatenverband und Reformen auf organisatorischem, politischem und wirtschaftlichem Gebiet werden die Voraussetzungen für einen Wiederaufstieg der Stadt geschaffen.
Wegen Baufälligkeit wird die Stiftskirche St. Simon und Judas "auf Abbruch" verkauft. Mit dem "Goslarer Dom" verliert die Stadt eines seiner wichtigsten Baudenkmäler, erhalten bleibt nur die nördliche Vorhalle.
Im "Neuen Lager" werden weitere große Erzvorkommen im Rammelsberg entdeckt. Das Bergwerk wird wieder wichtiger Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber, Besitzanteile hat die Stadt jedoch nicht mehr.
Die vom Verfall bedrohte Goslarer Kaiserpfalz wird restauriert. Nach Gründung des Deutschen Reiches intensivieren sich die Bemühungen, ihr den Charakter eines Nationaldenkmals zu geben.
Mit dem Einrücken amerikanischer Truppen endet in der "Reichsbauernstadt des 1000jährigen Reiches" die NS-Herrschaft. Wie in ganz Deutschland, so sind auch in Goslar in den vergangenen 12 Jahren die demokratischen Parteien und Institutionen zerschlagen worden, fast alle Mitglieder der kleinen jüdischen Gemeinde wurden deportiert und ermordet. Große Zerstörungen durch Bombenangriffe oder Kampfhandlungen gab es hingegen nicht.
Die Erzvorräte im Rammelsberg sind erschöpft, mit einem letzten Förderwagen endet ein weit über 1000jähriger kontinuierlicher Bergbaubetrieb. In den folgenden Jahren wird hier ein Besucherbergwerk und Bergbaumuseum von internationalem Rang ausgebaut.
Als elftes deutsches Kulturgut werden das Erzbergwerk Rammelsberg und die Altstadt Goslar in die UNESCO-Liste des Welterbes aufgenommen.
Mit einem feierlichen Gelöbnis wird das letzte Luftwaffenausbildungsbataillon, das auf dem Fliegerhorst Goslar stationiert war, außer Dienst gestellt. Damit endet die 51jährige Geschichte des Bundeswehrstandortes Goslar.
In der ehemaligen Rammelsberg-Kaserne wird die Einweihung des Energie-Forschungszentrums Niedersachsen (EFZN) gefeiert. Das EFZN wurde als wissenschaftliche Einrichtung der Technischen Universität Clausthal gegründet, um die bestehenden niedersächsischen Kompetenzen entlang der Energiekette zusammenzuführen und dadurch die niedersächsische Energieforschung als Ganzes voranzutreiben.
Das UNESCO-Welterbekomitee nimmt die Oberharzer Wasserwirtschaft als Erweiterung der Welterbestätte Bergwerk Rammelsberg und Altstadt Goslar in die Liste des Kultur- und Naturerbes auf.
Die bisher selbstständige Stadt Vienenburg (mit den Stadtteilen Immenrode, Lengde, Lochtum, Weddingen und Wiedelah) wird in Goslar eingegliedert; die Stadt wächst damit um etwa 10.000 Einwohner.




